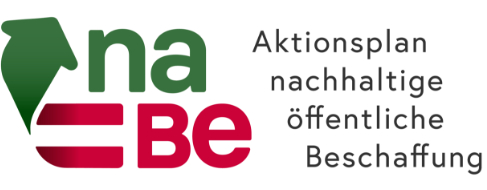Zusammenfassung
Mit dem Aktionsplan für nachhaltige Beschaffung verfolgt Österreich das Ziel, die öffentliche Beschaffung nachhaltiger zu gestalten. Ein effektives Monitoring ist gefragt, um Fortschritte messbar zu machen. Die Herausforderung: Was lässt sich hier eigentlich wie genau messen? Erste Pilotversuche zeigen, dass Datenqualität entscheidend ist.
Monitoring als Schlüssel zur Nachhaltigkeit
Wo steht die Umsetzung des naBe-Aktionsplans?
Mit dem Aktionsplan für nachhaltige Beschaffung verfolgt Österreich das Ziel, die öffentliche Beschaffung in seiner Bundesverwaltung nachhaltiger zu gestalten. Doch wie erfolgreich ist der naBe-Aktionsplan? Ein effektives Monitoring ist gefragt, um Fortschritte messbar zu machen. Die Herausforderung: Was lässt sich hier eigentlich wie genau messen? Erste Pilotversuche zeigen, dass Datenqualität und -integration entscheidend sind. Welche Aufgaben und Hürden hier für eine nachhaltige Beschaffung in Österreich genau bestehen, erfahren Sie hier.
Der naBe-Aktionsplan konkretisiert das Bundesvergabegesetz von 2018 inhaltlich bzw. das Gebot, im Vergabeverfahren auf Umweltverträglichkeit der Leistungen Bedacht zu nehmen (§ 20 Abs. 5 BVergG 2018). Als Rahmenwerk baut er vorwiegend auf Umweltgütezeichen auf und definiert rund 200 verbindliche Anforderungen (Kernkriterien) für 16 Produktgruppen. Obendrein stellt der Aktionsplan Empfehlungen und Entscheidungshilfen für operative Einkäuferinnen und Einkäufer zur Verfügung.
Um die Nachhaltigkeit von einzelnen Maßnahmen im Einkauf bewerten zu können und in der Folge die Umweltleistung einer Organisation zu verbessern, braucht es gute Daten. Zwar hat sich in Österreich in den letzten Jahrzehnten ein hochentwickeltes Beschaffungswesen etabliert. Viele Arbeitsabläufe und Prozesse passieren hierzulande längst vollelektronisch (e-Procurement). Neben der Bundesbeschaffung GmbH als zentraler Beschaffungsstelle und Vermittlerin auf zahlreichen Beschaffungsmärkten unterstützen auch weitere spezialisierte Dienstleister wie z. B. der Auftragnehmerkataster Österreich (ANKÖ) mit ihren Services. Doch viele elektronische Plattformen und Informationssysteme von Dienstleistern, Auftragnehmern und Auftraggebern schaffen auch Medienbrüche, die ein ganzheitliches Monitoring überbrücken muss. Um die Umsetzung und Wirkung des naBe-Aktionsplans zu messen sind aktuell Evaluierungsansätze auf vier Ebenen vorgesehen:
Zunächst ist die Institutionalisierung in den einzelnen Bundeseinrichtungen – hier werden Weisungen und Nominierungen von naBe-Beauftragten in Ministerien sowie Partnerschaften mit öffentlichen Unternehmen dokumentiert – im Blick. Auf einer zweiten Ebene bildet die Wirkung (Impact) von nachhaltiger Beschaffung auf gesamtstaatlicher bzw. volkswirtschaftlicher Ebene den Gegenstand des naBe-Monitorings. Untersuchungen wie eine Studie der Wirtschaftsuniversität Wien zum Government Footprint – zum weltweiten Materialverbrauch und zu den Treibhausgasemissionen des österreichischen öffentlichen Sektors – lieferten erste Anhaltspunkte, um die naBe-Kriterien weiterzuentwickeln oder um operative Maßnahmen zu identifizieren und zu gewichten. Eine Wirkungsanalyse des österreichischen Wirtschaftsforschungsinstituts (WIFO) zeigte zudem die faktischen Auswirkungen des naBe-Aktionsplans auf Wertschöpfung, Beschäftigung und die Reduktion von CO2-Emissionen auf.
Das sogenannte Pre-Award-Monitoring prüft Ausschreibungen nach ihrer Veröffentlichung in Stichproben, ob die naBe-Kriterien erfüllt worden sind. Good Practice-Beispiele sollen Machbarkeit veranschaulichen und öffentlichen Auftraggebern helfen, Kriterien in ihre Ausschreibungsunterlagen zu integrieren. Die Erfahrungswerte aus diesen Analysen können auch genutzt werden, um den naBe-Aktionsplan weiterzuentwickeln. Im Post-Award-Stadium hingegen liegt der Fokus auf der Analyse der faktischen Beschaffungsvorgänge – genauer auf den Anteilen von beschafften Produkten und Dienstleistungen, für die der Aktionsplan konkrete Kriterien formuliert, sowie dem Anteil an Beschaffungsgegenständen, die den Kriterien des Aktionsplans nachweislich entsprechen. Das Post-Award-Monitoring befindet sich in Österreich im Entwicklungsstadium. 2024 startete eine Pilotphase. Mit ersten Testauswertungen in ausgesuchten Produktgruppen wird der Status quo bezüglich Datenlage und -verfügbarkeit analysiert. Eine erste Erkenntnis: Zukünftige Monitoring-Systeme müssen (teil-)automatisiert und bereichsübergreifend funktionieren, denn die manuelle Auswertung von Millionen von Rechnungspositionen pro Jahr ist keine Option.
Im Fachdiskurs verschiebt sich das Interesse im Lichte neuer unionsrechtlicher Anforderungen weg von Produktauszeichnungen und Input-Indikatoren hin zu Output- sowie Outcome-Indikatoren wie bspw. dem CO₂-Fußabdruck von Beschaffungstätigkeiten. Die Weiterentwicklung des naBe-Monitorings bleibt somit eine zentrale Aufgabe der kommenden Jahre.
Weiterführende Links
Headerbild: © Adobe Stock
Beitragsbild: © Pixabay